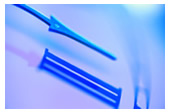Auf Wutwellen in sozialen Netzwerken sind viele Unternehmen nicht vorbereitet. Ein enger Kontakt zur Internetwelt hilft in solchen Situationen - oder Hotline-Erfahrung.
Ende Juli platzte der Vodafone-Kundin auf Facebook der Kragen: „Sobald meine Verträge ausgelaufen sind, wird alles gekündigt!!!“, schrieb sie auf der Internetseite des Mobilfunkanbieters. Fehlerhafte Abrechnungen habe der geschickt, 275 Euro eingezogen, obwohl das Handy ausgeschaltet gewesen sei, und der Kundenservice könne ihr auch nicht weiterhelfen. Eine „Sauerei“ sei das Ganze. Es dauerte nur eine Stunde, bis Vodafone eine Antwort an seine virtuelle Pinnwand heftete: mit vorgestanzten Textbausteinen und dem Hinweis, die Kundin möge sich an die Beschwerdehotline wenden. Danach gingen die Kollegen vom Marketing und aus der Technik, die den Facebook-Auftritt betreuten, erst einmal ins Wochenende - und der Shitstorm brach los. So heißen Massenproteste empörter Nutzer auf Firmenseiten in sozialen Netzwerken. Einmal losgetreten, entwickeln sie sich zumeist nach dem gleichen Muster.
Bis zum Montagmorgen klickten auf der Facebook-Seite von Vodafone mehr als 60 000 Internetnutzer „Gefällt mir“ unter dem digitalen Wutausbruch an, rund 6000 kommentierten den Beitrag der empörten Kundin oder steuerten eigene Beschwerden bei, die wiederum neue „Likes“ und Kommentare auf sich zogen. Aus der Beschwerde wurde eine Woge. Bald hielten Pöbeleien und Fäkalsprache Einzug, die Flut schwappte über auf den Kurznachrichtendienst Twitter und Blogs, um schließlich auch den traditionellen Medien eine Meldung wert zu sein, was neue Empörte auf den Plan rief. Immer mehr Unternehmen nutzen Facebook, Google+ und Twitter sowie die Karriereplattformen Xing und Linkedin, um Werbebotschaften unters Volk zu bringen und mit Kunden in Kontakt zu treten. Doch die verhalten sich dort nicht immer wie freundliche „Fans“. Denn öffentlichkeitswirksam Beschwerden loszuwerden, kostet auf den Plattformen nur einen Mausklick. In den vergangenen zwei Jahren sind Empörungslawinen in sozialen Netzwerken in Deutschland zur Mode geworden. Ob Henkel, McDonald’s, H&M oder ProSieben, die Deutsche Bahn, Nestlé, der WWF oder zuletzt Wiesenhof: Shitstorms scheinen jeden treffen zu können, jederzeit.
Nur wenige haben einen Plan für den digitalen Notfall
Gut darauf vorbereitet sind wohl nicht einmal Firmen der Informationswirtschaft. Das ist zumindest das Ergebnis einer Studie des Branchenverbands Bitkom: Von 172 befragten Unternehmen nutzen zwar 60 Prozent Facebook, doch nur 42 Prozent haben einen Plan für den digitalen Notfall in der Schublade. Ein Viertel der Firmen mit Facebook-Präsenz beschäftigt keinen festen Mitarbeiter für ihre Auftritte in sozialen Netzwerken, knapp ein Drittel einen einzigen, nur 41 Prozent haben zwei oder mehr. Die Hälfte der Befragten gibt den Social-Media-Mitarbeitern nicht vor, wie schnell sie auf Nutzeranfragen reagieren müssen. Von den Firmen, die Zeitfenster festlegen, veranschlagt wiederum die Hälfte eine Reaktionszeit von 24 Stunden oder mehr.
“Als wir am Montagmorgen ins Büro kamen, standen wir schon mitten im Sturm“, erinnert sich Alexander Leinhos, der die Presseabteilung von Vodafone leitet, an die Folgen von immerhin 64 Stunden Untätigkeit. In aller Eile wurde ein Team aus der PR-Abteilung, dem Social-Media-Bereich, Marketing und Kundenservice zusammengestellt, das auf allen Kanälen Fragen beantwortete, persönlich und ohne Sprachschablonen. Alle Stunde informierte der Mobilfunkbetreiber die Netzgemeinde, wie weit er mit der Aufklärung der ursprünglichen Beschwerde gekommen sei. Diese Back-ups könne man nicht an eine Agentur delegieren, sagt Leinhos. Nachdem die Kundin, die nicht unter ihrem echten Namen geschrieben hatte, kontaktiert und das Problem ausgeräumt war, dauerte es noch Tage, bis die Wogen sich glätteten.
Mehr als Stürme im Wasserglas?
Darüber, ob Shitstorms mehr sind als Stürme im Wasserglas, gehen die Meinungen auseinander. Eine Studie der Unternehmensberatung McKinsey kommt zu dem Schluss, das Phänomen sei überbewertet. Leinhos sagt, die Beschwerdelawine habe keinen messbaren Schaden angerichtet, unterschätzen wolle man die Attacken trotzdem nicht. Wer mehrmals nicht auf massenweise Kritik reagiere, schade seinem Image. „Der Shitstorm war für uns ein Schuss vor den Bug“, sagt er. Vodafone behält seine Social-Media-Präsenzen jetzt rund um die Uhr im Blick, ein technisches Frühwarnsystem erkennt verdächtige Bewegungen auf den Websites, Zuständigkeiten und Entscheidungswege für den Krisenfall sind geklärt, und eine Kommunikationsschulung soll helfen, sofort den richtigen Ton zu finden.
Ob eine Wutwelle das Potential zum PR-Desaster habe, hänge nicht allein von der Stärke des Ansturms ab, sondern von seiner Qualität. Das ist die Einschätzung des Krisenkommunikationsforscher Andreas Schwarz von der Technischen Universität Ilmenau. „Zu den Faktoren, die einen Shitstorm potentiell gefährlich machen, gehören die Legitimität der Initiatoren oder Auslöser und die Legitimität ihres Anliegens“, sagt er und nennt als Beispiel für ein bedrohliches Szenario die Empörungswelle, die Greenpeace mit dem Vorwurf, Nestlé bedrohe den Lebensraum des Orang-Utans, gegen den Konzern angestoßen hat.
Aber auch unbedenklichere Fälle wie der dreiwöchige „Wurstkrieg“ der ING Diba binden Arbeitszeit und Personal. Gut 20 Vegetarier und Veganer sorgten im vergangenen Sommer auf der Facebook-Seite der Bank für Wirbel, weil Dirk Nowitzky in einem Werbespot eine Scheibe Fleischwurst isst, und lieferten sich eine wütende Debatte über Fleischkonsum und Tierrechte mit bis zu 2500 Kommentaren täglich. „Wir hätten unsere Hausregeln durchsetzen und die Posts löschen können“, sagt André Kauselmann von der Unternehmenskommunikation. Doch das löst in der Regel noch aufgebrachtere Reaktionen aus. Stattdessen habe das Social-Media-Team sich wie der Gastgeber einer WG-Party verhalten, moderiert und Toleranz gezeigt, bis das Spektakel vorbei war - eine willkommene Form der Selbstdarstellung.
Den World Wildlife Fund (WWF) Deutschland hat dagegen vor einem Jahr eine Empörungswelle getroffen, die einen fundamentalen Wert zu unterspülen drohte: seine Glaubwürdigkeit. Auslöser war ein Dokumentarfilm, der die Organisation beschuldigte, mit umweltzerstörenden Konzernen zu kollaborieren. Die Auseinandersetzung darüber, ob der Film ein falsches Bild vermittelt oder nicht, führen inzwischen Anwälte. Die Netzgemeinde reagierte schon mit einem Sturm der Entrüstung, als die Erstausstrahlung im Fernsehen lief.
Kritik bis hin zu Morddrohungen
Damals kümmerte sich eine einzige Mitarbeiterin um die deutschen Social-Media-Auftritte der Umweltschützer. 1700 Fragen stürmten allein in den ersten zwei Tagen des Shitstorms auf sie ein. In den folgenden vier Wochen zählte der WWF Deutschland 4,6 Millionen Kontakte auf seiner Facebook-Seite, 839.000 Kontakte auf Twitter, 26.000 Views auf seinem Youtube-Kanal und 263.000 Besucher auf der Homepage. „Burning House“ nennt Astrid Deilmann das, da helfe nur noch maximale Transparenz. Deilmann leitet die Abteilung Digitale Kommunikation der Umweltschutzorganisation in Deutschland, die nach der Kritikwelle geschaffen wurde.
Vier Wochen mit zehn Personen quasi rund um die Uhr alle Fragen beantworten, rasch Informationen aus vertrauenswürdigen Quellen herbeischaffen und der Kritik standhalten, die schnell persönlich wurde und sich bis zu Morddrohungen steigerte, das bedeutete der Shitstorm für den WWF. Der Großteil der wütenden Nutzer seien keine Netz-Randalierer gewesen, sondern emotional tief getroffene Sympathisanten oder Förderer, also die wichtigste Klientel, erzählt Deilmann. „Die Leute da draußen sind klug, sie recherchieren hervorragend und zeigen Defizite auf. Das haben wir auf die harte Tour gelernt.“ Der WWF habe heute zwar mehr Mitglieder, Follower und Fans als vor der Krise, aber Deilmann ist überzeugt: Ihre Organisation ist jetzt vorbelastet. Beim nächsten Mal werde man noch weniger Zeit haben, Vorwürfe auszuräumen.
Gespür für die Netzgemeinde ist wichtig
Der WWF hat sich gewappnet: mit einer neuen Kommunikationsabteilung, Dienst- und Einsatzplänen für den Notfall und einer Social-Media-Redakteurin, die sich nur um Fans und Follower kümmert. Motivierte Anhänger gelten als wichtige Verbündete in der Auseinandersetzung mit aufgebrachten Kritikern. Der Informationsfluss zwischen dem Büro in Deutschland und Projekten im Ausland wurde verbessert, Fragen beantwortet die Organisation auch auf einer Dialogplattform.
Wer Shitstorms managen soll, muss ein Gespür dafür haben, wie die Netzgemeinde tickt. „Wenn sich ein Unternehmen in die sozialen Netzwerke wagt, sollte es eine Strategie damit verfolgen und Kommunikationsfachleute nach vorne schicken“, sagt der Forscher Andreas Schwarz. Denn letztlich ginge es auch ohne Krise darum, Stimmungen in der Online-Community aufzufangen. Dass sich als Social-Media-Beauftragte bestens Menschen eignen, die jünger als 30 Jahre sind, ist die Erfahrung von Astrid Deilmann vom WWF. Die frühere Journalistin ist zwar wenige Jahre älter, hat aber schon während des Studiums eine, wie sie findet, hervorragende Zusatzqualifikation für die Bewältigung von Shitstorms erworben: als Aushilfe in einer Beschwerde-Hotline. (Quelle: F.A.Z.)