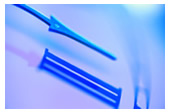|
|
 Aktuelles November 2017 Aktuelles November 2017
|
|
|
Die 8 Dimensionen digitaler Unternehmenskultur |
Digitale Unternehmenskultur: Dimensionen Infografik
Bild: Capgmini Consulting

Die agile Organisation ist die erfolgreichste Organisationsform bei der digitalen (Unternehmenskultur-)Transformation.
Unternehmen mit einer ausgeprägten digitalen Kultur haben zufriedenere Mitarbeiter und größeren wirtschaftlichen Erfolg, so das Ergebnis der Change Management Studie 2017 von Capgemini Consulting. Doch was macht eigentlich eine digitale Unternehmenskultur aus?
Im Rahmen der Studie „Culture First!“ hat Capgemini Consulting qualitative Interviews mit 20 Wissenschaftlern und Vorreitern der digitalen Transformation aus Unternehmen wie beispielsweise Google, IBM und SAP geführt. Die Fragestellung lautete: Welche Merkmale kennzeichnen die Kultur von Unternehmen, die bei der digitalen Transformation bereits weit gekommen sind? Welche Denk- und Verhaltensweisen, welche Werte und Normen und welche Art von Führung prägt diese digitale Kultur? In Kooperation mit der Universität Innsbruck haben die Berater von Capgemini Consulting anschließend acht unterschiedliche Dimensionen digitaler Kultur herausgearbeitet.
Merkmale einer digitalen Unternehmenskultur
1. Kundenorientierung
Eine Kultur mit hoher Kundenorientierung zeichnet sich dadurch aus, dass der Kunde ins Zentrum von Denken und Handeln gestellt wird. Es herrscht ein enger Austausch sowie individuelle Interaktion und Kommunikation mit den Kunden. Lösungen werden gemeinsam entwickelt und kontinuierlich an die Bedürfnisse des Kunden angepasst. Der Dialog mit dem Kunden wird durch digitale Tools gefördert. Kundenbedürfnisse und Wünsche werden fortlaufend anhand von digitalen Daten und Tools analysiert
2. Entrepreneurship
Unternehmen mit einer hohen Ausprägung in der Dimension „Entrepreneurship“ zeichnen sich durch die Integration aktueller Marktimpulse und Trends in ihr bestehendes Geschäftsmodell aus. Mitarbeiter werden ermutigt und befähigt, Risiken einzugehen und eigene Ideen voranzutreiben. Sie spielen daher eine aktive Rolle bei der Mitgestaltung des Unternehmens. Wettbewerb wird als Motivation und Quelle für Anregung wahrgenommen. Das eigene Geschäftsmodell wird kontinuierlich analysiert und entsprechend sich verändernder Marktverhältnisse und neuer technologischer Trends angepasst. Auch wenn es Risiken birgt, wird danach gestrebt, eigenständig Veränderungen am Markt auszulösen
3. Autonome Arbeitsbedingungen
Unternehmen, die sich durch autonome Arbeitsbedingungen auszeichnen, gewähren ihren Mitarbeitern Freiräume zum eigenverantwortlichen Arbeiten. Genutzt werden flexible Arbeitsmodelle, die es den Mitarbeitern zum Beispiel über digitale Tools ermöglichen, selbst über Arbeitszeiten sowie den Arbeitsort zu entscheiden. Dabei werden die Selbstständigkeit, Eigeninitiative und Selbstführung der Mitarbeiter gefördert und durch die internen Unternehmensstrukturen unterstützt. Die Mitarbeiter erleben dadurch einen hohen Grad an Gestaltungs- und Entscheidungsspielraum.
4. Kollaboration
Organisationen und Unternehmen mit einer hohen Ausprägung in der Dimension „Kollaboration“ fördern den interdisziplinären und bereichsübergreifenden Austausch unter ihren Mitarbeitern, mit Kunden und Wettbewerbern sowie zu und mit anderen Unternehmen. Das Sammeln und vor allem auch das Teilen und Strukturieren von Wissen wird als essentiell angesehen. Die Mitarbeiter unterstützen sich gegenseitig, auch über Bereichs- und Hierarchiegrenzen hinweg. Sie nutzen Synergien und überwinden das Silo-Denken. Ein hoher Grad an Partizipation und gelebter Offenheit ist hier ebenso in den Unternehmenswerten verankert wie der allem zu Grunde liegende Teamgeist. Digitale Technologien, wie zum Beispiel digitale Plattformen, werden gezielt dazu eingesetzt, Kollaboration zu ermöglichen und zu fördern. (Einen Überblick hierzu gibt auch die Infografik "Social Collaboration in deutschen Unternehmen" von Campana & Schott.)
5. Digitale Technologien und digitalisierte Prozesse
Die Verwendung digitaler Technologien und digitalisierter Prozesse ist ein zentraler Faktor dieser Dimension. Digitale Tools und Plattformen werden hierbei für die Weiterentwicklung der internen und externen Prozesse genutzt. Entscheidungen werden datenbasiert getroffen. Es besteht Offenheit gegenüber neuen Technologien als Basis für zukunftsorientierte Geschäftsmodelle. Nutzerorientierte, effiziente Prozesse flankieren diese Haltung. Digitale Technologien werden im Unternehmen flächendeckend zur Planung, Durchführung und Analyse von Arbeitsprozessen und Ergebnissen eingesetzt.
6. Agilität
Agile Unternehmen setzen auf dynamisches Denken und Handeln. Sie zeichnen sich durch eine schnelle Anpassungsfähigkeit auf sich verändernde Umweltbedingungen und Kundenbedürfnisse aus. Diese Anpassungsfähigkeit wird unter anderem durch die hohe Ambiguitätstoleranz der Führungskräfte und Mitarbeiter sowie der Flexibilität des Unternehmens als Ganzes unterstützt. Neue Impulse werden schnell aufgenommen, bewertet und umgesetzt. Die agilen Prozesse und Strukturen werden dynamisch und bedarfsgerecht angepasst und unterstreichen die hohe Veränderungsbereitschaft des Unternehmens. (Lesen Sie auch: Die sechs Dimensionen der agilen Organisation und Agilität als Meta-Erfolgsfaktor der digitalen Transformation).
7. Digital Leadership
In dieser Dimension liegt ein starker Fokus auf der Entwicklung der Mitarbeiter. Die Führungskräfte vermitteln ihnen eine klare digitale Vision und Strategie. Außerdem haben die Führungskräfte eine ausgeprägte Mitarbeiterorientierung. Sie befähigen die Mitarbeiter und agieren als Coach, um ihnen in ihrer Entwicklung zu helfen. Die Führungskräfte bringen ihren Mitarbeitern ein hohes Maß an Vertrauen entgegen. Dadurch werden die Bindung an das Unternehmen sowie die Loyalität der Mitarbeiter zum Unternehmen gestärkt. Führungskräfte nutzen auch die Möglichkeiten von digitaler Führung. Sie arbeiten mit Teams unabhängig von Zeit und Ort zusammen. Mehr zum Thema "Digital Leadership" lesen Sie im Beitrag "Führen im Digitalzeitalter".
8. Innovation und Lernen
Unternehmen mit einer hohen Innovations- und Lernorientierung sehen die Weiterentwicklung des Unternehmens und ihrer Mitarbeiter als einen der wichtigsten Erfolgsfaktoren an. Es wird ein kreativitätsförderndes Umfeld geschaffen, das Experimentierfreudigkeit und Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Ideen fördert. Um sich schnell an verändernde Gegebenheiten anpassen zu können, werden bisherige Gewohnheiten und Prozesse kritisch hinterfragt. Fehlschläge werden als Teil des Entwicklungsprozesses akzeptiert und Scheitern als wichtiger Lernprozess angesehen. So entsteht die Bereitschaft, Neues zu wagen.
Digitale Unternehmenskultur messen: Wo stehen Unternehmen bei der digitalen Transformation?
Auf Basis dieser Erkenntnisse hat Capgemini Consulting einen Online-Fragebogen entwickelt. Darin wurde jede einzelne der acht definierten Kulturdimensionen über durchschnittlich vier individuell zu bewertende Aussagen erfasst. Mit einer Auswahlskala von 1 (= Bestehendes ausschöpfen) bis 10 (= Digitalisierung vorantreiben) konnten die Teilnehmer ihre Einschätzung zu den Aussagen zum Ausdruck bringen. Daraus ermittelte Capgemini Consulting bei allen teilnehmenden Unternehmen „Digital Culture Scores“ zwischen 1 und 10 für jede der acht Kulturdimensionen sowie einen Digital-Culture-Gesamtscore.
Digitale Unternehmenskultur bringt wirtschaftlichen Erfolg und zufriedene Mitarbeiter
1.139 Teilnehmer haben im Rahmen der Studie den Online-Fragebogen beantwortet. Über alle Teilnehmer hinweg fand sich im Ergebnis eine signifikante positive Korrelation zwischen Digital-Culture-Gesamtscore und finanziellem Unternehmenserfolg (Korrelationskoeffizient r = .27) sowie zwischen Digital-Culture-Gesamtscore und Mitarbeiterzufriedenheit (r = .21).
Das Fazit der Studienautoren: "Je ausgeprägter die digitale Kultur der Unternehmen ist, desto erfolgreicher sind sie finanziell. Und je stärker die Unternehmenskultur die Bedingungen des Digitalzeitalters erfüllt, desto zufriedener sind die Mitarbeiter. Das hat natürlich wiederum einen positiven Rückkopplungseffekt auf den Unternehmenserfolg zur Folge. Insofern hängen die beiden Einzelresultate eng miteinander zusammen."
Agile Unternehmen: Erfolgreichste Organisationsform für die Digitalisierung
Ein Vergleich der Organisationsformen mit dem Digitalisierungserfolg (siehe Abbildung), zeigte sich in der Studie, dass Unternehmen mit einer agilen Organisation mit einigem Abstand die höchsten Digital Culture Scores aufweisen (5,99). "In Anbetracht der zur Digitalisierung passenden Charakteristika dieser Organisationsform ist das wenig verwunderlich", so die Studienautoren. "Wir sehen hier einen weiteren Anhaltspunkt dafür, dass der Dreiklang von Strategie, Organisation und Kultur die besten Ergebnisse hervorbringt."
(Quelle: Haufe Online Redaktion)
|
Data Driven Marketing
Nichts mit Customer Experience: Das Handling der Kundendaten überfordert Unternehmen
|
Das Handling der Kundendaten überfordert Unternehmen
Marketer tun sich schwer, mit den Kundendaten sinnvoll zu arbeiten.
Unternehmen verfügen heute über eine Vielzahl verschiedener Kundendaten. Mit der Verwaltung und Analyse sind sie jedoch überfordert. Das hat eine Studie einmal mehr ergeben. Entsprechend leidet die Customer Experience - und das bestätigen auch die Kunden.
Ziel der internationalen Studie (durchgeführt in 14 Ländern) war es, zu verstehen, wie Unternehmen weltweit die von Verbrauchern gesammelten Daten verarbeiten, schützen, auswerten und nutzen, um personalisierte Kundenerlebnisse bereitzustellen. Außerdem wurden die Kunden zu ihren Erfahrungen befragt.
Fest steht: Unternehmen und Marken stehen unter Druck, datengesteuertes Marketing zu betreiben. 86 Prozent messen der Personalisierung einen hohen Stellenwert bei. Die Verwaltung und Analyse der Kundendaten bereitet ihnen jedoch Probleme – die Customer Experience bleibt auf der Strecke. Infolgedessen geben die Kunden an, dass die Personalisierung bei vielen Marken schlecht ist und – mehr noch – es sich bei näherer Betrachtung nicht einmal um eine echte Personalisierung handelt.
95 Prozent der befragten Verbraucher sind unzufrieden mit der Art und Weise wie Unternehmen Kundendaten nutzen. 63 Prozent der deutschen Befragten (weltweit 57 Prozent) geben an, dass mit veralteten Daten gearbeitet wird oder schlichtweg falsche Daten zum Einsatz kommen (Deutschland: 60 Prozent; weltweit: 57 Prozent).
Zur Analyse der Kundendaten fehlt es an Wissen
Für Unternehmen sind schlecht personalisierte Daten in der Regel das Ergebnis einer Datenflut, mit der sie derzeit nicht umgehen können. Marken sammeln den eigenen Angaben nach im Durchschnitt acht verschiedene Arten von Daten über Onlinekunden, angefangen bei Transaktionen bis hin zu Einblicken in Verhalten und Trends. Dennoch gibt mehr als ein Viertel der befragten Unternehmen an, dass die nötigen Kompetenzen fehlen, um die gesammelten Daten richtig zu nutzen oder zu analysieren. 28 Prozent fehlt bisher die Möglichkeit, gesammelte Daten zu integrieren. Gerade einmal acht Prozent können Onlinedaten auf Ebene des Individuums (anstatt des Verbrauchersegments) sammeln.
Unternehmen müssten schnellstens Maßnahmen ergreifen, um die Datennutzung zu verbessern, sagt Scott Anderson, CMO des Kontext-Marketing-Spezialisten Sitecore. Sie müssten endlich die Fähigkeit erlangen, das Sammeln, Verknüpfen, Auswerten und Nutzen der vorhandenen Kundendaten zu professionalisieren.
Das Problem: Viele Unternehmen besitzen weder die richtigen Tools noch das Know-how, um sich weiterzuentwickeln und die Erwartungen der Kunden zu erfüllen. So haben beispielsweise nur acht Prozent der Unternehmen die Möglichkeit, Onlinedaten auf Ebene des Individuums zu sammeln, obwohl 66 Prozent angeben, eine digitale Analysesoftware zu verwenden.
Auf die Frage, was sie sich bei einer Customer-Experience-Lösung am meisten wünschen, nannte fast jedes zweite Unternehmen (neben der individuellen Nutzung von Kundendaten), Echtzeiteinblicke in das Kundenverhalten zu erlangen. Jedes Dritte wäre gerne in der Lage, Kundendaten in die Kanäle, über die sie bezogen werden, zu integrieren.
(Quelle: acquisa Online Redaktion)
|
Der neue EU-Datenschutz: Wird er künftigen Herausforderungen gerecht? |
Im Sommer 2018 tritt die europaweite Datenschutzgrundverordnung in Kraft. Was Verbrauchern Vorteile verspricht, bringt viele Unternehmen in Bedrängnis. Viele sind bislang nur unzureichend vorbereitet.
Diese fünf Tipps nehmen der Verordnung ihren Schrecken
- Viele Unternehmen hadern mit Betroffenenrechten und Meldepflichten
- Verarbeitungsverzeichnisse und Einwilligungserklärungen sind Pflicht
- Selbst wenn die Grundthemen geklärt sind, gibt es eine Menge zu tun
Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) tritt am 25. Mai 2018 in Kraft und stellt jedes Unternehmen vor große Herausforderungen. Man sollte bereits heute den Status der schon etablierten Maßnahmen und Prozesse kennen und kritische Themen zeitnah angehen. Dazu gilt es, folgende fünf Themen als Einstieg zu adressieren. Diese Aufstellung hilft im ersten Schritt, die Basis zu setzen, um im zweiten Schritt die DSGVO nachhaltig und vollständig zu erfüllen.
Betrachtet man die wesentlichen durch die DSGVO vorgegebenen Datenschutzprozesse (datenschutzkonforme Verarbeitung, Sicherstellung der Betroffenenrechte, Handhabung von Datenschutzverletzungen), so stellt man im Dialog mit Unternehmen fest, dass der erste Prozess noch weitgehend gut adressiert wird, die Themen Betroffenenrechte und Datenschutzverletzungen jedoch viele vor wirklich große prozessuale und technische Herausforderungen stellen. Darüber hinaus sucht man oft vergeblich nach einer Datenschutzleitlinie oder einem Verarbeitungsverzeichnis (zu Zeiten des Bundesdatenschutzgesetzes war dies das Verfahrensverzeichnis). Welches Unternehmen ist heute beispielsweise darauf vorbereitet, das Recht eines Betroffenen auf Zugriff oder Datenübertragbarkeit sicherzustellen?
Als Erstes ist die Bestellung eines internen oder externen Datenschutzbeauftragten notwendig, diese ist nach Artikel 37 der DSGVO aufgrund diverser dort festgelegter Kriterien für die meisten Unternehmen verpflichtend. Das Grundhandwerkszeug des Datenschutzbeauftragten besteht, neben vielen anderen Dingen, aus dem Verfahrensverzeichnis (zukünftig Verarbeitungsverzeichnis genannt) sowie der regelmäßigen Durchführung aller notwendigen Mitarbeiterschulungen und Vorabkontrollen, deren Ergebnisse in einen regelmäßig zu erstellenden Datenschutzbericht einfließen. Basis für seine Arbeit ist die Datenschutzleitlinie.
Alle Mitarbeiter des Unternehmens müssen eine Verpflichtungserklärung (DSGVO Artikel 32) unterschrieben haben; für die Speicherung und weitere Verarbeitung personenbezogener Daten sollte grundsätzlich eine Einwilligungserklärung (DSGVO Artikel 7) eines jeden Betroffenen vorliegen.
- Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung
Werden Systeme mit personenbezogenen Daten außerhalb des eigenen Hauses betrieben, muss dies mit einem Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung (DSGVO Artikel 28) unterlegt werden. Liegen derartige Verträge nicht vor, sollten diese umgehend geschlossen werden. Bestehende Verträge wären zu überprüfen.
- Zutritte, Zugänge und Zugriffe
Technisch muss es klar dokumentierte und angewandte Verfahren zu den Themen Zutrittskontrolle, Zugangskontrolle und Zugriffskontrolle (DSGVO Artikel 32) geben. Besonders wichtig hierbei ist die lückenlose Protokollierung aller Zutritte, Zugänge und Zugriffe.
Man sollte im Hinblick auf die zukünftig deutlich detaillierter festgelegten Rechte der Betroffenen (DSGVO Artikel 13 ff.), zum Beispiel das Recht auf Löschung und das Recht auf Vergessen werden, die vorhandenen Systeme und Prozesse dahin gehend prüfen, wie derartige Anforderungen umsetzbar sind.
Die zukünftig geltende Pflicht, Datenschutzverletzungen innerhalb von 72 Stunden zu melden, wird ebenfalls große Herausforderungen an die bestehende System- und Prozesswelt stellen.
Fangen Sie jetzt mit diesen fünf Hausaufgaben an, um auf den 25. Mai 2018 vorbereitet zu sein! Sind diese erledigt, gibt es eine Fülle weiterer Anforderungen, Maßnahmen und Prozesse, die bis zur vollständigen Adressierung der DSGVO umzusetzen oder einzuführen sind. Die Umsetzung dieser fünf Themen hilft, dem Thema DSGVO den Schrecken zu nehmen.
(Quelle: Xing.com/ Peter K. Albrecht-Digitalisierungsexperte, Scopar GmbH)
|
Die Datenschutz-Grundverordnung verständlich erklärt
|
Den Unternehmen bleibt nicht mehr viel Zeit, um sich mit den neuen Datenschutz-Bestimmungen zu befassen.
Ab dem 25. Mai 2018 gilt das neue EU-Datenschutzrecht. Wer sich nicht daran hält, riskiert empfindliche Strafen. Die Rechtsexperten von Trusted Shops erklären die neuen Bestimmungen für Rechtslaien verständlich anhand von zehn Geboten.
Gesetzestexte sind bekanntermaßen nicht jedermanns Sache, denn leicht verständlich sind sie selten.
Trusted Shops hat die Regeln der neuen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) deshalb verständlich zusammengefasst.
Hier die "zehn Gebote“:
Was geschrieben steht, sollst Du befolgen. Im E-Commerce gelten die Regeln aufgrund der intensiven Datenverarbeitung für alle Unternehmen, egal wie groß oder klein.
Du sollst Zeugnis über Deine Taten ablegen. Die Einhaltung der Anforderungen der DS-GVO müssen Unternehmen jederzeit nachweisen können. Sie sind daher verpflichtet, ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten zu führen.
Du sollst schätzen, welche Gefahr Dein Handeln bringt. Rechte und Freiheiten Betroffener dürfen durch die Datenverarbeitung nicht gefährdet werden. Die automatisierte, systematische und umfassende Datenerfassung birgt Risiken, die in der sogenannten Datenschutzfolgeabschätzung dargestellt werden muss.
Du sollst tun, was zum Schutz getan werden muss. Datenschutzverletzungen müssen durch den geeigneten Einsatz von technischen und organisatorischen Maßnahmen (TOM) vermieden werden. Sollte es dennoch zu Verletzungen kommen, müssen diese binnen 72 Stunden gemeldet werden.
Datenschutz-Grundverordnung: Ausführlichere Verträge, mehr Informationspflichten
Du sollst Deine Verträge sorgsam schließen. Verträge zur Auftragsdatenverarbeitung werden ausführlicher und müssen den Einsatz von Subunternehmen enthalten, zum Beispiel beim Einsatz von Analysetools und beim Webhosting.
Du sollst den Willen anderer achten. Die Datenverarbeitung ist zulässig, wenn eine Einwilligung vorliegt. Die Anforderungen an diese Einwilligung werden verschärft: Das Mindestalter beträgt beispielsweise 16 Jahre.
Du sollst gründlich erklären. Mit der neuen Datenschutz-Grundverordnung entstehen zusätzliche Informationspflichten. Unter anderem muss die Datenschutzerklärung detaillierter erfolgen.
Du sollst dem Menschen lassen, was seines ist. Die Menschen, deren Daten verarbeitet werden, haben das Recht, diese zu einem anderen Anbieter, Dienstleister oder einer anderen Plattform "mitnehmen“ zu können. Um das zu gewährleisten, muss die Portabilität der Daten gesichert werden.
Du sollst zum Wohl der Menschen Deine Speicher leeren. Kunden können verlangen, dass ihre Daten vollständig gelöscht werden, wenn sie ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung widerrufen, die Speicherung der Daten nicht mehr notwendig ist, die Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden oder eine Rechtspflicht zum Löschen nach EU- oder nationalem Recht besteht. Dies wird als das "Recht auf Vergessenwerden“ bezeichnet.
Du sollst wissen, welche Buße Dir auferlegt werden kann. Bei Verstößen drohen nach neuem Recht Bußgelder von bis zu 20 Millionen Euro oder von bis zu vier Prozent des gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes.
(Quelle: acquisa Online Redaktion)
|
Newsletter - Sieben goldenen Regeln im E-Mail-Marketing
|
Der Newsletter ist immer noch das Marketinginstrument mit dem besten Kosten-Nutzen-Faktor. Kein Wunder also, dass E-Mail-Marketing nach wie vor zu den beliebtesten digitalen Marketingmethoden gehört. Neben gesetzlichen Vorschriften gibt es eine ganze Menge an einfachen, aber sehr wichtigen Benimmregeln für dieses Instrument, die schnell zwischen Erfolg und Misserfolg entscheiden können.
Ehrliche Betreffzeile
Missverständliche oder geradeaus gelogene Betreffzeilen schaden jedem. Es schadet dem Kunden, da er so wertvolle Zeit vertrödelt, bis er merkt, dass er geködert wurde. Und es schadet Ihnen, weil Sie nicht nur das Vertrauen des Kunden verlieren, sondern vermutlich auch einen Abonnenten und zukünftigen Kunden. Die Open Rate eines Newsletters kann noch so gut sein, aber nachhaltigen Erfolg erzielen Sie nur, wenn der Kunde mindestens das bekommt, was die Betreffzeile vermuten lässt. Nicht weniger. Die Betreffzeile sollte kurz und klar formuliert sein und vor allem mit ehrlich sein.
Transparenz zeigen
In Zeiten, in denen jeder Mensch dutzende bis hunderte E-Mails am Tag bekommt, ist es wichtig, dass der Empfänger schnell einordnen kann, wer ihm eine E-Mail sendet. Machen Sie keinen Hehl daraus, wer Sie sind und auch nicht, dass es sich bei dem Newsletter natürlich über eine Werbemaßnahme handelt. Zwingend erforderlich ist ein Impressum. Außerdem schafft es Vertrauen, wenn Sie neben Ihrer Adresse auch weitere Kontaktmöglichkeiten in die E-Mail integrieren.
Opt-out einfach machen
Es ist mittlerweile Pflicht, dass die Möglichkeit zur Abmeldung bei jedem Newsletter „klar und deutlich“ gezeigt wird. Ganz abgesehen davon, sollte das Ziel nicht sein, jemanden als Abonnenten zu halten, der eigentlich nicht den Newsletter haben will. Gehen Sie lieber offensiv mit dem Thema um, und platzieren Sie die Abmeldemöglichkeit nicht im Kleingedruckten, sondern separat und deutlich.
Keine Call-to-Action Flut
Ein Button hier, ein Button dort – zu viele Button, Boxen und bunte Aufmerksamkeitserreger wirken ebenfalls kontraproduktiv. Ein guter Newsletter sollte keine schrille Litfaßsäule sein, sondern einfach und deutlich den Inhalt präsentieren und den Nutzer dabei nicht überfordern.
Gigantismus sein lassen
Der moderne Mensch leidet nicht nur an Reizüberflutung, sondern auch an einer gesunden Skepsis. Zu oft wurden ihm Produkte oder ein Service als „Das absolut Beste“ verkauft. Übertreiben Sie es deswegen in Ihrem Newsletter nicht mit dem Eigenlob. Frei nach dem uralten Erzählgesetz „Zeigen, nicht erzählen“, sollten Sie ihn lieber mit Taten überzeugen. Wenn Sie etwas anpreisen, dann machen Sie Ihren potenziellen Kunden zu einem Teil davon. Fragen Sie ihn, was er sich von etwas erwartet oder wie man ein vorhandenes Produkt noch besser machen kann.
Klare, wiederkehrende Struktur
Wenn sich der Newsletter-Empfänger als erstes fragt, wo in der E-Mail oben und unten ist, haben Sie bereits verloren. Wichtig ist nicht nur, dass sich der potenzielle Kunde in Ihrem Newsletter zurechtfindet, sondern dass er ihn bei jedem Mal wiedererkennt und sich im Idealfall auch wohlfühlt. Eine klare, übersichtliche Struktur kann hier genauso wie ein durchdachtes und nicht überflutetes Design helfen.
Nicht nur Werbung
Es ist verständlich, dass Sie Ihren Newsletter für die Verbreitung von Produktneuheiten und anderen Marketinganliegen verwenden wollen. Im Content-Marketing-Zeitalter sollte das aber nicht der einzige Verwendungszweck sein. Fragen Sie sich, was Ihren Kunden wohl noch helfen könnte und integrieren Sie hilfreiche Artikel, unterhaltsame Videos und Grafiken, die die Verbindung zwischen Ihnen und Ihrer Zielgruppe stärken. E-Mail-Marketing mag einer der ältesten digitalen Kanäle sein; so behandelt werden sollte er aber keinesfalls.
(Quelle: haufe.de)
|
Gerichtsverfahren vs. Mediation – welche Vorteile bietet die außergerichtliche Alternative?
|
Die Mediation hat viele Vorteile.
Bei festgefahrenen Konflikten gibt es verschiedene Möglichkeiten, eine dritte Instanz zur Klärung einzuschalten. Der absolute Klassiker unter ihnen ist und bleibt das Gerichtsverfahren. Daneben kommen aber auch diverse außergerichtliche Alternativen wie die Schlichtung, ein Schiedsverfahren, die Einschaltung eines Ombudsmanns oder eine Mediation in Betracht. Obwohl diese Verfahren häufig die deutlich bessere Option zur Konfliktlösung sind, sind sie als Werkzeuge der Streitschlichtung noch immer recht unbekannte und häufig skeptisch gesehene Werkzeuge.
Die Mediation zeichnet sich dadurch aus, dass sie mithilfe verschiedener Kommunikationstechniken die Hintergründe des Konflikts aufarbeitet und herausfiltert, welche Emotionen, Interessen und Bedürfnisse hinter dem Streit stecken. Der Mediator bringt die Streithähne zurück ins Gespräch miteinander und unterstützt sie dabei, gemeinsam eine Lösung für ihren Konflikt zu entwickeln. Gegenüber dem Gerichtsverfahren kann diese Methode viele Vorteile haben – auch wenn nicht jeder Streit für eine einvernehmliche Lösung geeignet ist. Insgesamt gesehen wird es aber nur einen kleinen Prozentsatz an Streitigkeiten geben, bei dem nur ein Richter entscheiden kann. Bei der Mehrheit lohnt es sich hingegen, die Mediation zumindest zu versuchen.
Prinzip der Eigenverantwortung: Konfliktparteien bleiben bis zum Schluss die Herrscher des Verfahrens
Die Eigenverantwortlichkeit der Konfliktparteien gehört zu den wichtigsten Grundideen der Mediation. Das bedeutet, die Konfliktparteien sind selbst für den Inhalt des Mediationsverfahrens und die Lösung ihres Konflikts verantwortlich. Damit entscheiden die Konfliktparteien, die man Medianten nennt, z. B. was wie und wie lange besprochen wird. Der Mediator trägt lediglich die Verantwortung für den Prozess und damit den Ablauf der Mediation sowie für die Strukturierung des Verfahrens. Er unterstützt die Medianten bei der Bearbeitung ihres Konflikts, jedoch ohne sich inhaltlich einzumischen. Im Gegensatz zum Schlichter oder Richter macht der Mediator keinerlei Lösungsvorschläge bzw. trifft keinerlei Entscheidung bezüglich des Konflikts.
Bei der Mediation geben die Streitenden den Konflikt somit nicht aus der Hand, sondern bleiben bis hin zur Lösung selbst für ihren Konflikt und dessen Lösung verantwortlich. Die Medianten sind daher bis zum Schluss die Herrscher des Verfahrens. Sie delegieren die Entscheidungsfindung und Konfliktbearbeitung nicht an Anwälte und Richter, sondern versuchen selbstbestimmt, in eigener Verantwortung eine Einigung zu erarbeiten, wobei ihnen der Mediator hilft. Zwar wird auch das deutsche Zivilrecht vom Grundgedanken der Autonomie der Prozessgegner getragen, jedoch gilt das nur bis zu einem gewissen Punkt. Kläger und Beklagte können deshalb zwar selbst bestimmen, welche Anträge sie stellen, welchen Sachverhalt(steil) sie vorbringen und welche Beweismittel sie anbieten, die Entscheidung des Richters und seine Bewertung der Rechts- und Beweislage können sie aber nicht mitbestimmen. Das letzte Wort spricht vor Gericht deshalb der Richter. Bei der Mediation liegt die Entscheidung über die Lösung des Konflikts bei den Medianten, die freiwillig entscheiden, ob sie die erarbeiteten Lösungsoptionen annehmen wollen oder nicht.
Betrachtung des gesamten Konflikts: Statt einzelne Rechtsfragen zu klären, werden die Hintergründe des Konflikts aufgearbeitet
Vor Gericht geht es nur um die streitigen Rechtsfragen, also ob der Anspruch auf Zahlung der Summe X aufgrund eines Kaufvertrags, wegen bestehender Mietmängel oder zur Abgeltung von Urlaubsansprüchen besteht. Die Mediation betrachtet dagegen nicht nur die Fragen, welche rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sein müssen, welcher Sachverhalt nachgewiesen ist und ob damit die gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind, sondern sie betrachtet den gesamten Konflikt. Die Mediation ergründet dabei, welche Interessen, Bedürfnisse und Wünsche hinter den rechtlichen Forderungen bzw. Positionen der Medianten stehen. Sie fragt nicht, wem was zusteht, sondern interessiert sich vielmehr dafür, warum es gewollt ist.
Bildlich wird dieser Unterschied zwischen Gerichtsverfahren und Mediation häufig anhand des Streits um eine Orange verdeutlicht. Dabei streiten sich zwei Schwestern um eine Orange. Beide Schwestern wollen unbedingt die ganze Orange für sich haben. Ein Gericht würde in diesem Fall lediglich klären, welche der beiden Schwestern rechtlich gesehen die Eigentümerin der streitgegenständlichen Orange ist. Die Mediation hinterfragt die Gründe der beiden Schwestern und findet heraus, dass Schwester Nummer eins erkältet ist und den Saft der Orange zur Stärkung der Abwehrkräfte trinken möchte. Schwester Nummer zwei möchte hingegen einen Kuchen backen und benötigt dafür die Schale einer ganzen Orange. Mit diesem Wissen lässt sich der Streit der beiden Schwestern um eine Orange leicht so lösen, dass die Interessen beider Schwestern berücksichtigt werden können, denn während Nummer eins den Saft erhält, bekommt Nummer zwei die Schale.
Konfliktlösung als Ziel: Im Ergebnis wird kein Machtwort gesprochen, sondern der Konflikt endgültig gelöst
Im Gegensatz zum Gerichtsverfahren geht es bei der Mediation nicht um die Entscheidung eines Richters über Recht und Unrecht, sondern die Medianten arbeiten an einer gütlichen Einigung zum beiderseitigen Nutzen. Formal beendet der Richter zwar auch den Streit zwischen den Konfliktparteien, jedoch nur in Bezug auf die vorgebrachten Anträge nach der Rechts- und Beweislage. Der dahinterstehende Konflikt ist damit aber meist noch lange nicht gelöst. Zum einen stellt die Schlacht vor Gericht meist nur die Spitze des Eisbergs dar und zum anderen wird die Entscheidung nach Rechts- und Beweislage in vielen Fällen nicht gerade als fair und gerecht empfunden. Die Entscheidung des Richters ist daher nur in wenigen Fällen zur Konfliktlösung geeignet. In den meisten Fällen verhärtet sie die Fronten eher weiter.
Am Ende der erfolgreichen Mediation steht dagegen eine tatsächliche Lösung des Konflikts. Statt den Versuch zu unternehmen, die Rechtslage zu bewerten, stellt die Mediation nämlich die Interessen der Streithähne in den Mittelpunkt der Verhandlung und fragt danach, wie der Konflikt konsensual geregelt werden kann. Hierzu wird nicht nach einem Schuldigen gesucht oder herausgefunden, „wer recht hat“. Vielmehr arbeitet die Mediation in ihren Sitzungen auf, was tatsächlich hinter dem Konflikt steckt, welche Emotionen, Interessen und Wünsche eine Rolle spielen und was die Medianten eigentlich wollen. Auf dieser Basis wird eine Lösung entwickelt, die alle Seiten gleichermaßen zufriedenstellt und damit den Konflikt tatsächlich löst.
Nachhaltige Lösung: Die in der Mediation erarbeitete Lösung hat auch in Zukunft Bestand
Die in der Mediation gefundene Lösung erweist sich auch in der Zukunft als besonders nachhaltig. Dies hat drei Gründe: Zum einen fokussiert sich die Mediation nicht wie das Gerichtsverfahren auf die Vergangenheit, sondern bearbeitet die Gegenwart und Zukunft. Die Vergangenheit wird dabei nur so weit reflektiert, wie es zur Konfliktlösung erforderlich ist. Zum zweiten betrachtet die Mediation nicht nur eine Rechtsfrage, sondern sie leitet die Parteien vielmehr dazu an, die Gründe ihres eskalierten Konflikts zu suchen und mit dem Blick in die Zukunft eine Lösung zu finden, die allen Seiten gerecht wird. Die Basis für die gemeinsame Suche nach Lösungsoptionen stellt dabei das in den vorherigen Phasen der Mediation entwickelte gegenseitige Verständnis der Parteien dar. Der dritte und letzte Grund für die besondere Nachhaltigkeit der Mediation ist schließlich, dass die beiden Streitenden die Lösung selber gemeinschaftlich erarbeitet haben, sodass beide hinter der Lösung stehen.
Nur Gewinner: win-win statt lose-lose
Mit dem Richterspruch verlieren häufig beide Seiten. Auch wenn eine Partei vom Richter recht bekommt, hat der Prozess häufig z. B. die Geschäftsbeziehung oder Freundschaft endgültig zerstört. Nach der Mediation ist hingegen eine Lösung gefunden, die beide Seiten zufriedenstellt und die Beziehung der Streitenden so oft erhält.
Vor Gericht kämpfen beide Seiten erbittert um Sieg oder Niederlage, ohne dass Gemeinsamkeiten, gemeinsame Ziele oder Wünsche und die eigentlichen Interessen eine Rolle spielen. In der Mediation sind die Konfliktparteien dagegen weder auf die Rechtslage noch auf die Entweder-oder-Option beschränkt. Vielmehr haben sie innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, um eine gemeinschaftliche Lösung mit Vorteilen für beide Seiten zu finden. Die Mediation wandelt den Konflikt daher im besten Fall in eine Win-win-Situation um oder findet zumindest einen fairen Ausgleich, bei dem keine der Parteien etwas verliert.
Weniger Kosten: Mediation frisst nicht so viele Ressourcen wie ein langjähriger Gerichtsstreit
Der Mediator lässt sich seine Dienstleistung zwar auch bezahlen, die Kosten sind aber meist viel niedriger als die Kosten eines Gerichtsprozesses, bei dem Gerichtsgebühren, Anwaltskosten, Kosten für Gutachter usw. anfallen. Der Gerichtsprozess bringt deshalb immer ein erhebliches finanzielles Risiko mit sich, denn die Kosten des Prozesses muss am Ende der Verlierer zahlen.
Die Kosten für die Dienstleistung des Mediators werden vorab in der Mediationsvereinbarung nach Stunden- oder Tagessätzen festgelegt. Selbst wenn diese Kosten auf den ersten Blick hoch erscheinen, sind sie im Vergleich zu den Gerichtskosten, die sich am Streitwert bemessen, in vielen Fällen deutlich günstiger. Das gilt vor allem dann, wenn für den Gerichtsprozess teure Gutachten (z. B. zur Bewertung einer Firma oder Immobilie oder Feststellung von Baumängeln) eingeholt werden müssen.
Vertraulichkeit: Mediationen finden nicht in der Öffentlichkeit, sondern in einem geschützten Raum statt
Gerade im wirtschaftlichen Umfeld spielt die Vertraulichkeit der Mediation einen ganz großen Faktor. Unternehmen verlieren in Prozessen schon deshalb, weil vor Gericht der Grundsatz der Öffentlichkeit gilt. Jedes besprochene Detail kann in der Presse landen oder von im Publikum sitzenden Konkurrenten verwertet werden.
Die Mediation findet hingegen in einem rein privaten Umfeld statt und die Vertraulichkeit ist einer der zentralen Grundsätze der Mediation. Dieser Punkt wird daher auch schon in der Mediationsvereinbarung aufgegriffen, in der sich Mediator und Medianten verpflichten, alle Informationen in der Mediation vertraulich zu behandeln. So wird ermöglicht, über alle notwendigen Informationen und Hintergründe für die Konfliktlösung zu sprechen. Da keinerlei Information nach außen dringt, wird so praktisch auch eine etwaige Rufschädigung ausgeschlossen.
Schnelligkeit: wenige Mediationssitzungen statt jahrelanger Instanzenzug
Last, but not least ist der Mediator keine Behörde, sondern ein privater Dienstleister, der seine Arbeit unmittelbar nach Abschluss der Mediationsvereinbarung aufnehmen kann. Die Mediation ist deshalb deutlich schneller als der Gang vor Gericht. Viele Konflikte benötigen nur wenige Mediationssitzungen, und selbst wenn der Konflikt komplex ist und weit mehr Mediationssitzungen erfordert, wird die Mediation sicher nicht so viele Jahre benötigen wie der Instanzenzug.
(Quelle: anwalt.de)
|
Was kostet es Mediationen NICHT durchzuführen?
|
Wieviel Geld und Zeit spart man wirklich, wenn eine Mediation anstelle eines Gerichtsverfahrens tritt? Forscher des ADR-Centers (Rom) stellten sich diese Frage und entwickelten bereits 2011 ein Verfahren, um den Zeit- und Kostenaufwand eines Gerichtsverfahrens mit dem Aufwand für eine Mediation zu untersuchen. Die Kosten eines Gerichtsverfahrens wurden dem Weltbank-Bericht Doing Business 2009 entnommen, in dem die durchschnittlichen Gerichtskosten, sowie Anwaltskosten für einzelne Länder aufgeführt sind. Wie aber lassen sich vergleichbare Daten für das Mediationsverfahren gewinnen? Hierfür betrachteten die Forscher die Länder Belgien und Italien, in denen ein System der gerichtsnahen Mediation vorliegt.
Dass ein Mediationsverfahren insgesamt schneller und günstiger ist, wird immer wieder gerne als Argument für dieses alternative Konfliktlösungsverfahren angeführt. Dass aber die Zahlen so eindeutig sind, ist doch überraschend: So geht aus der Auswertung des Datenmaterials hervor, dass bei einer hohen Erfolgsquote von Mediation (in Belgien und Italien liegt diese bei 75%) ca. 220 Tage und 5.000 € in Belgien und 860 Tage und über 7.000 € in Italien eingespart werden.
Ein weiteres Ergebnis der Forschung ist die Berechnung des Break-Even-Punkts, ab wann eine Mediation günstiger als ein Gerichtsverfahren ist. So ist ein Mediationsverfahren, das mit einer Erfolgsquote von 19%, schneller und mit einer Erfolgsquote von 24%, kostengünstiger als ein Gerichtsverfahren. So lässt sich zusammenfassen, dass Mediation in sehr vielen Fällen eine kosten- und zeitsparende Alternative zum Gerichtsverfahren darstellt.
Die Autoren der EU-finanzierten Studie fordern daher eine bessere Implementierung von Mediation in Gerichtsverfahren. Auch wenn der Begriff der „obligatorischen“ Mediation oft Kritik hervorruft – da es sich um ein freiwilliges Verfahren handelt – befürworten die Autoren dennoch ein System der gerichtsinternen Mediation. Wenn bspw. ein Mediationsversuch vor der Eröffnung eines Gerichtsverfahrens obligatorisch ist, dann haben auch mehr Menschen Zugang und Kenntnis von dieser alternativen Konfliktlösungsmethode, so das Argument.
Sicherlich sind nicht alle Gerichtsverfahren dazu geeignet in einer Mediation bearbeitet zu werden. Doch schaut man auf die wegweisenden Zahlen dieser Studie, so ist es nicht weiter verwunderlich, dass in der Zwischenzeit zahlreiche Modellprojekte von Mediation an Gerichten auch in Deutschland durchgeführt werden (-> einen Überblick finden sie hier: http://www.kbbe.de/informationen/mediation/gerichtsnahe-mediation/).
(Quelle: die-mediation.de)
|
| |
|
|